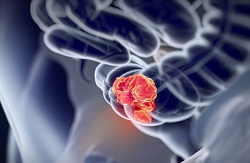Organoide im Kampf gegen Krebs
Darmkrebs entsteht im Epithel des Magen-Darm-Traktes, in den meisten Fällen in Folge von Treibermutationen im Tumor-Suppressor-Gen APC (adenomatöse Polyposis Coli). APC-Mutationen bewirken eine Überflutung der Stammzellen des Darms mit Signalen und steigern die Expression von Zielonkogenen wie etwa MYC (c-Myc). Es ist offensichtlich, dass für die Entstehung von Darmkrebs zusätzliche Ereignisse wie etwa Mutationen in den Genen KRAS und TP53 notwendig sind, die an der Regulierung wichtiger Zellprozesse wie zum Beispiel dem Zellzyklus beteiligt sind. Jedoch sind die Auswirkungen dieser Veränderungen auf die Entwicklung von Darmkrebs und das Ansprechen auf eine Therapie nicht genau geklärt. Um dieses Problem anzugehen und den Darmkrebs weiter zu erforschen, entwickelte Owen Sansom, Empfänger einer EFR-Finanzhilfe und Leiter des EU-finanzierten ColonCan-Projekts, mehrere präklinische Modelle, die den Verlauf der Krankheit beim Menschen einschließlich Metastasierung originalgetreu rekapitulieren. „Unser Ziel bestand darin, mögliche neuartige Targets und Therapien für Darmkrebs zu ermitteln und zu testen“, erklärt Prof. Sansom. Hauptziel war die Bewertung der Auswirkungen kooperierender Mutationen und die Entschlüsselung jener Signalmechanismen, durch die diese genetischen Veränderungen zum Phänotyp APC-defizienter Zellen beitragen. Präklinische Darmkrebsmodelle Die Forscher nutzten die modernsten Technologien, etwa ribosomales und metabolisches Profiling, um Darmkrebszellen aus ihren präklinischen Modellen zu untersuchen. Sie entdeckten, dass KRAS-Mutationen die Signaltransduktion innerhalb von APC-defizienten Darmkrebszellen verändern. Die Projektergebnisse deuteten auf einen Gesamtanstieg der globalen Proteinproduktion und Änderungen der Nährstoff-Stress-Reaktionswege und des Zellstoffwechsels in den Zellen hin, in denen beide Mutationen vorkommen. Außerdem entdeckte man, dass der Wachstumsfaktor TGF-β die Tumorentstehung in den Darmzellen unterdrückt. Das Forscherteam generierte außerdem mithilfe von Gentechnologie neue Mausmodelle für metastasierenden Darmkrebs. Ein Vergleich der aus diesen Modellen erzeugten transkriptomischen Daten mit den Humandaten für primären Darmkrebs ergab, dass die Modelle den Krebs-Subtypen mit der schlechtesten Gesamtüberlebenszeit nachvollziehen. „Diese neuen Modelle können zum Testen therapeutischer Wirkstoffe und zur Modellierung geschichteter klinischer Studien eingesetzt werden, und sie sind eine ausgezeichnete Plattform zum Testen von Immuntherapiekombinationen“, fährt Prof. Sansom fort. Überdies wurden erhebliche Anstrengungen unternommen, um Organoidkulturen als Ex-vivo-Darmkrebsmodelle oder zur orthotopischen Transplantation in Mäuse zu entwickeln. Mit dieser neuen Technik werden im Wesentlichen die Eigenschaften und die dreidimensionale Struktur des ursprünglichen Tumors nachgeahmt, wie er aus tumorauslösenden Zellen entsteht. Neuartige Behandlungen gegen Darmkrebs Sämtliche präklinischen Modelle wurden dazu verwendet, die derzeit verfügbaren Darmkrebstherapien zu testen. Interessanterweise beobachteten die Wissenschaftler Arzneimittelresistenzen gegenüber vielen zielgerichteten Therapien, was darauf hindeutet, dass dringend alternative Ansätze erforderlich sind. Prof. Sansom unterstreicht die klinische Bedeutung der ColonCan-Studie „aufgrund der Identifizierung neuer Möglichkeiten zur Behandlung von Darmkrebs.“ Tatsächlich hat sich das Abzielen auf Nährstoffstress und/oder Stoffwechsel als ein spezifischer Ansatz zum Abtöten von Darmkrebszellen mit Mutationen sowohl in den APC- als auch den KRAS-Genen herausgestellt. In Anbetracht der Tatsache, dass ungefähr 40 % der Darmkrebspatienten beide Mutationen in sich tragen, weisen diese Erkenntnisse auf neue Behandlungswege für fortgeschrittenen Darmkrebs. Zusammengefasst beschreiben die von ColonCan neu generierten Modellsysteme (Mäuse und Organoide) genau die Situation beim Menschen und werden als leistungsfähige Werkzeuge zur Erprobung neuer therapeutischer Strategien dienen. „Ultimatives Ziel ist der Einsatz dieser Modelle zur Förderung von Studien über neuartige Behandlungen“, so Prof. Sansom. Zur Beschleunigung klinischer Studien arbeiten die Forscher an der Einrichtung einer europäischen präklinischen Plattform für Kreuzvalidierung von Modellen und therapeutischer Versuche bei Darmkrebs.
Schlüsselbegriffe
ColonCan, Darmkrebs, APC, KRAS, Organoid