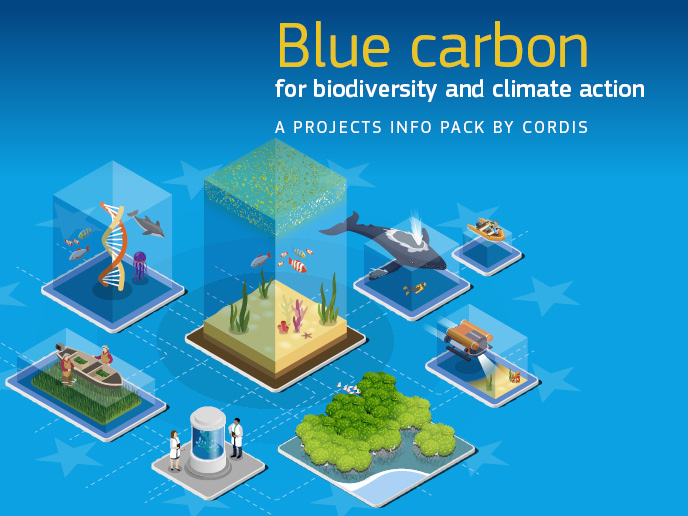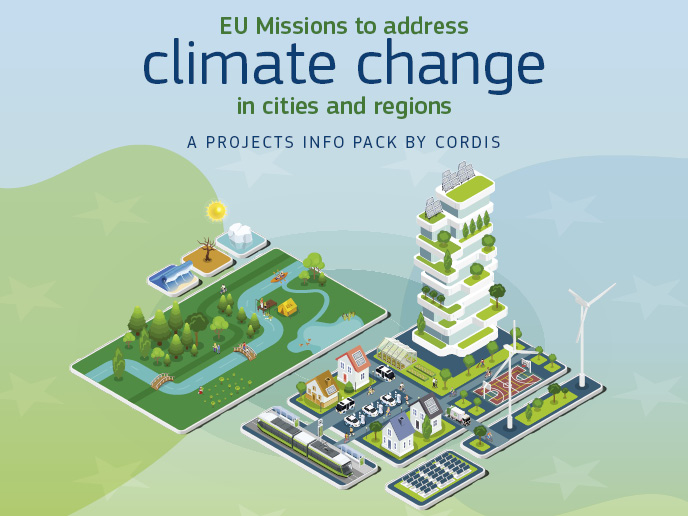Die Macht des indigenen Wissens nutzen
Indigene und lokale Gemeinschaften verfügen über ein ausgezeichnetes Wissen über ihre Umwelt und die biologische Vielfalt und wissen, wie sie auf nachhaltige Weise mit ihrer Umgebung interagieren können. Gleichzeitig ist dieses Wissen oft mit kulturellen Praktiken und Normen verwoben, die sich von denen der Wissenschaft stark unterscheiden. Beispielsweise können kulturelle Tabus und spirituelle Praktiken im Umgang mit dem Wald für die lokale Nachhaltigkeit bei der Erhaltung der Wälder von zentraler Bedeutung sein, lassen sich aber nur schwer mit dem modernen Verständnis der Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen in Einklang bringen. Im Rahmen des Projekts LOCAL KNOWLEDGE(öffnet in neuem Fenster) wurde die Frage gestellt, wie diese Kluft auf sowohl sensible als auch wirkungsvolle Weise überbrückt werden kann, und es wurde das Konzept der Philosophie der Ethnobiologie aufgestellt. David Ludwig(öffnet in neuem Fenster), außerordentlicher Professor in der Gruppe Knowledge, Technology and Innovation(öffnet in neuem Fenster) (KTI) der Universität Wageningen in den Niederlanden, erklärt dazu: „Wir denken meist an ‚Philosophie‘ als eine reflexive Praxis, die ein sorgfältiges Nachdenken über all die komplizierten Fragen ermöglicht, die sich aus der Vielfalt des Wissens ergeben.“ Die Idee, wie Philosophie anwendbar ist, entwickelt sich weiter. „Wir betrachten die Philosophie auch zunehmend als eine ‚Vermittlerin‘ zwischen verschiedenen Wissensformen, Werten und Weltanschauungen“, erläutert Ludwig. Wie er erklärt, gibt es viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die eine inklusivere Arbeitsweise anstreben und anerkennen, dass indigene Gemeinschaften über viel relevantes Wissen verfügen. „Aber sie wissen nicht, wie sie mit Wissen umgehen sollen, das nicht ihren disziplinären Normen entspricht und das tief in lokalen Kulturen verwurzelt ist. Hier kann die Philosophie zwischen verschiedenen Perspektiven vermitteln und zum besseren Verständnis beitragen.“
Wissenschaftliche Verfahren mit lokalem Wissen verknüpfen
In Bereichen wie Landwirtschaft, Naturschutz und Gesundheit wird viel über die „Integration“ von indigenem und akademischem Wissen gesprochen. Diese Integration ist jedoch schwierig und manchmal unmöglich. Indigene Gemeinschaften und wissenschaftlich Tätige verwenden sehr unterschiedliche Methoden, und das qualitative Wissen einer Gemeinschaft passt möglicherweise nicht zu den quantitativen Verfahren der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Koloniale Vorgeschichten und Machtgefälle können eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe erschweren. Bei ernsthaften Versuchen, Wissen gemeinsam zu generieren, müssen diese methodologischen Herausforderungen angegangen werden. Ludwig verweist auf das Beispiel von Tabus – etwa das Verbot, zu bestimmten Zeiten im Jahr zu fischen oder in bestimmten Waldgebieten zu jagen. „Viele lokale Tabus haben spirituelle Begründungen und sind für Forschende schwer nachvollziehbar. Gleichzeitig sind sie oft wichtige Bestandteile nachhaltiger Beziehungen zwischen Gemeinschaften und ihrer Umwelt, die ein Überjagen und die übermäßige Entnahme von Ressourcen verhindern“, stellt er fest.
Interdisziplinäre Forschungsmethodik
Um beide Ansätze zu vereinen, hat das Team von LOCAL KNOWLEDGE eine interdisziplinäre Forschungsmethodik entwickelt, die philosophische Analysen und empirische Zusammenarbeit mit drei ethnobiologischen Forschungsteams in Brasilien und Mexiko integriert. In Brasilien hat das Team(öffnet in neuem Fenster) gemeinsam mit lokalen Lehrkräften Schulmaterialien entwickelt, um das Wissen der Fischereigemeinschaft zu vermitteln und es mit akademischem Wissen über Themen wie den Klimawandel zu verknüpfen. „Wir haben bewiesen, wie wichtig das Wissen der Fischereigemeinschaft für wirkungsvollere Naturschutzstrategien zum Schutz lokaler Fischarten ist. So verbietet die brasilianische Politik beispielsweise den Fischfang während bestimmter Monate, um die Fische während der Eiablage zu schützen. Aber die Fischereigemeinschaften vor Ort haben uns gesagt, dass die Gesetze nicht mit den Monaten übereinstimmen, in denen die Fische tatsächlich ihre Eier ablegen: Eine Anpassung der Politik im Sinne des lokalen Wissens würde daher bedrohten Arten sehr zugutekommen“, erklärt Ludwig. In Mexiko wurden im Rahmen des Projekts Pflanzenkrankheiten untersucht, die Kaffeepflanzen befallen. Viele dieser Krankheiten sind erst vor kurzem aufgetaucht, sodass es kein indigenes Wissen darüber gibt, wie sie zu bekämpfen sind.
Dringende sozial-ökologische Probleme angehen
Die projektintern erforschten Ideen sind in einem Buch mit dem Titel LINK (Transformative Transdisziplinarität) dargelegt, das von Charbel El-Hani(öffnet in neuem Fenster), einem ordentlichen Professor am Institut für Biologie der Bundesuniversität Bahia(öffnet in neuem Fenster) (Website auf Portugiesisch) in Brasilien, mitverfasst wurde. Dieses Buch wird nächstes Jahr bei Oxford University Press erscheinen. „Als der Philosophie Verpflichtete denken wir über alle möglichen hochrelevanten Themen nach, vom Klimawandel bis zur sozialen Gerechtigkeit. Aber oft bleibt unklar, wie unser Denken zu mehr als einem intellektuellen Spiel wird und die Menschen beeinflusst“, fügt er hinzu. „Ich bin jetzt viel zufriedener mit meiner Arbeit, und auch zuversichtlicher, als noch vor dem Start des Projekts des Europäischen Forschungsrats(öffnet in neuem Fenster).“