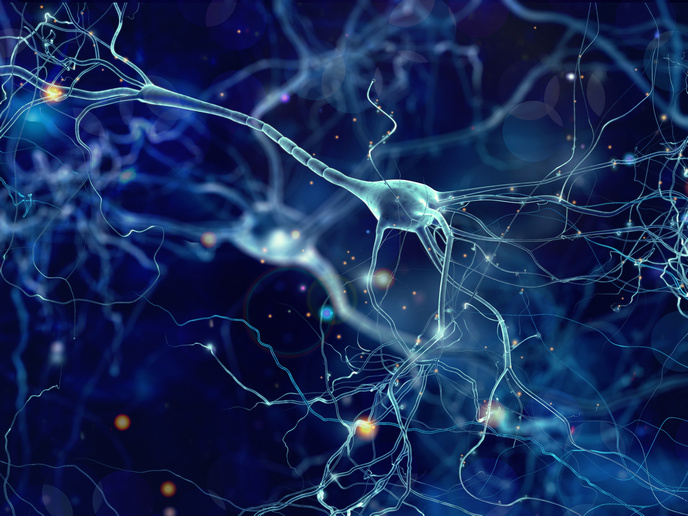Digitale Zwillinge des Gehirns für mehr Behandlungserfolg
Laut einem in „Lancet“ veröffentlichten Paper(öffnet in neuem Fenster) sind neurologische Störungen heute weltweit die häufigste Ursache für gesundheitliche Einschränkungen. Im Jahr 2018 waren rund 7,85 Millionen Menschen in der EU von Demenz(öffnet in neuem Fenster) betroffen und Schätzungen(öffnet in neuem Fenster) zufolge steigt diese Zahl bis 2050 auf 14,3 Millionen an. Über 6 Millionen Menschen in Europa(öffnet in neuem Fenster) sind von Epilepsie betroffen, während psychische Erkrankungen laut der OECD(öffnet in neuem Fenster) jedes Jahr Kosten in Höhe von rund 600 Milliarden Euro verursachen. Die Entwicklung neuer Diagnosetechniken und Fortschritte bei der Rechenleistung und der Nutzung künstlicher Intelligenz führen zur Entstehung innovativer Methoden für die Modellierung von Krankheitsverläufen und Behandlung. Eine Möglichkeit hierfür ist die Verwendung digitaler Zwillinge. „Neurotwins sind personalisierte Ganzhirn-Modelle, die Elektromagnetismus integrieren, um individuelle Hirnströme oder die Gewebeerzeugung und die Physiologie zu bestimmen, damit das Verhalten der Gehirnnetzwerke ersichtlich wird. Sie prognostizieren die individuelle Reaktion auf Stimulation, sodass wir die Therapie spezifisch anpassen können“, erklärt der Mitbegründer von Neuroelectrics Barcelona(öffnet in neuem Fenster) Giulio Ruffini(öffnet in neuem Fenster). Ruffini koordinierte das Projekt Neurotwin(öffnet in neuem Fenster), dessen Ziel darin bestand, modellbasierte, personalisierte Therapien bereitzustellen, um die Behandlungsergebnisse für Menschen mit Alzheimer und anderen Erkrankungen zu verbessern.
Modellierung nichtinvasiver Hirnstimulation zur Vorhersage der physiologischen Auswirkungen transkranieller elektrischer Stimulation
Eine der Herausforderungen bei der Behandlung psychischer Erkrankungen besteht in der richtigen Vorhersage der Auswirkungen von Therapien wie der transkraniellen elektrischen Stimulation (tES). Durch die Entwicklung modellbasierter Iterationen des individuellen Gehirns und die Erstellung eines digitalen Zwillings zeichnet sich ein klareres Bild von den Folgen von Eingriffen ab. „Modellgestützt bedeutet für uns, dass wir die Scans der Patientinnen und Patienten verwenden, um ein prädiktives digitales Zwillingsmodell zu erstellen, anzupassen und zu validieren, und dann die Montage, Intensität, Frequenz und den zeitlichen Ablauf in silico (Simulation) optimieren – und iterativ mit neuen Daten aktualisieren“, sagt Ruffini. „Der mechanistische Charakter der von uns entwickelten Modelle ist von entscheidender Bedeutung. Unsere Modelle sind keine Blackboxen mit Milliarden von Parametern. Sie basieren auf einem physiologischen, mechanistischen Verständnis der Funktionsweise des Gehirns. Dadurch sind sie von Grund auf einfacher und besser interpretierbar“, fügt er hinzu. Das Team verfolgte einen dreigleisigen Ansatz. Kopfphysik: Ausgehend von einem MRT/CT werden die durch die Gehirnstimulation erzeugten elektrischen Felder mithilfe von Finite-Elemente-Modellen(öffnet in neuem Fenster) berechnet. Dabei handelt es sich um keine Echtzeit-Bildgebung, sondern um eine Simulation, um zu sehen, wohin die Hirnströme tatsächlich fließen, und die richtigen Montagen zu designen. Gehirndynamik: Für personalisierte Ganzhirn-Netzwerkmodelle, die auf Basis abgeleiteter Neurobildgebungsdaten (beispielsweise MRT, dMRT, fMRT oder EEG) den individuellen Schwingungen/Konnektivitäten entsprechen. In-silico-Therapiedesign: Dabei werden relevante tES-Protokolle am Zwilling getestet, um diejenigen auszuwählen, die voraussichtlich zur Gesundheit betragen werden. „Scans liefern anatomische Informationen, um elektrische Felder besser zu erfassen; hybride Gesamtmodelle prognostizieren physiologische Veränderungen im Laufe der Zeit. Ohne Vorhersage ist die Dosierung von Mensch zu Mensch unschlüssig, was zu unterschiedlichen Ergebnissen beiträgt“, bemerkt Ruffini. „Seit Jahren behandeln wir die Stimulation wie eine Blackbox. Mit personalisierten ,Neurotwins‘ können wir bessere Diagnosen stellen und sichere ,Was-wäre-wenn‘-Tests durchführen, bevor wir Maßnahmen ergreifen. Dies öffnet die Tür für eine präzise, konsistente Personalisierung und dosierte Behandlung der Patientenschaft.“
Klinische Studien öffnen die Türe zu einer breiteren Verwendung von Neurotwins für die Personalisierung der Behandlung
Dank der EU-finanzierten Wissenschafts- und Innovationsförderung konnte das Projekt seinen Ansatz durch eine artenübergreifende Analyse und eine randomisierte, doppelblinde Crossover-Pilotstudie(öffnet in neuem Fenster) mit einer scheinbehandelten Kontrollgruppe validieren. Die Studie(öffnet in neuem Fenster), die in Rom an der IRCCS Fondazione Santa Lucia(öffnet in neuem Fenster) (Website auf Italienisch) durchgeführt wurde, umfasste eine tägliche, modelloptimierte und individualisierte tES, die 30 Patientinnen und Patienten mit leichter bis mittelschwerer Alzheimer-Krankheit über einen Zeitraum von 8 Wochen in 40 Sitzungen zu Hause verabreicht wurde. „Unsere klinische Studie und unsere Studien mit gesunden menschlichen Probandinnen und Probanden unterstreichen die Auswirkungen von tACS bei einer Gammaleistung von 40 Hz. „Wir haben eine funktionierende Pipeline identifiziert, die von der individuellen Anatomie und Physiologie bis hin zu einer modellgestützten, zu Hause verabreichbaren Dosierung bei einer fragilen Bevölkerungsgruppe reicht“, sagt Ruffini. Das Team möchte nun die Anzahl der multizentrischen Studien zunächst für Patientinnen und Patienten mit Alzheimer nach oben skalieren, und die Ergebnisse dann auf Epilepsie und andere neurologische Erkrankungen ausweiten. Für Ruffini ist klar, dass die bisher geleistete Arbeit nur der Anfang auf dem Weg zu modellbasierten Interventionen in der Neuropsychiatrie ist: „Unser Ziel ist es, die neuronale Netzwerkdynamik aller Patientinnen und Patienten anhand eines normativen (gesunden) Modells zu quantifizieren, und dann die Stimulation auszuwählen, die voraussichtlich dazu beiträgt, das individuelle System wieder in Richtung dieses gesünderen Zustands zu versetzen.“