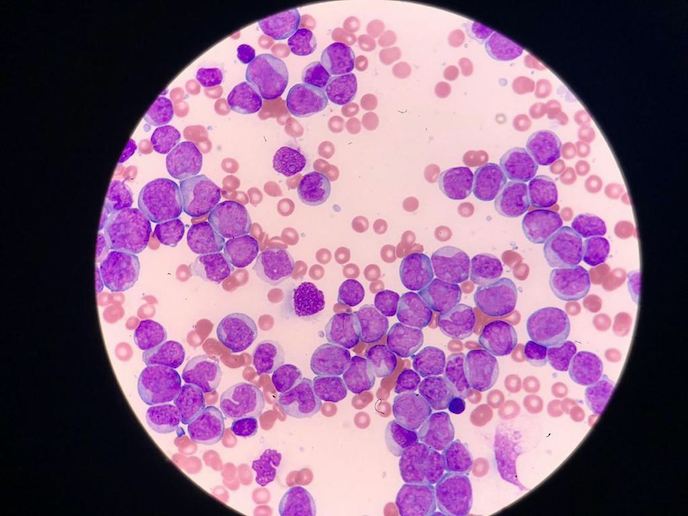Auf der Suche nach einem Heilmittel gegen das Denguefieber
Das Dengue-Virus(öffnet in neuem Fenster) (DENV) wird durch Stechmücken übertragen und löst die als Denguefieber(öffnet in neuem Fenster) bekannte Erkrankung aus. Es ist in tropischen und subtropischen Regionen verbreitet und kommt in über 130 Ländern vor – damit ist umgerechnet rund die Hälfte der Weltbevölkerung vom Virus betroffen. Jedes Jahr infizieren sich über 390 Millionen Menschen mit DENV. Während bei der Mehrheit nur leichte Symptome auftreten, kommt es bei mehr als 500 000 Infizierten zu einem schweren Krankheitsverlauf mit möglicherweise tödlichen Folgen. Angesichts steigender Temperaturen, zunehmender Verstädterung und internationaler Reisen ist damit zu rechnen, dass sich das Verbreitungsgebiet von DENV weiter ausdehnen wird und somit ein Anstieg der Infektionszahlen zu erwarten ist. Ein wirksamer Impfstoff und entsprechende Arzneimittel sind daher umso dringender nötig. Das EU-finanzierte Projekt FINDER steht bei diesem Forschungsbemühen an vorderster Front. „Unser Projekt konzentrierte sich auf eine erste Identifikation neuer virostatischer Verbindungen, die gegen Denguefieber-Infektionen wirksam sein könnten“, so Andrea Brancale, Professor für medizinische Chemie an der Universität Cardiff(öffnet in neuem Fenster). „Dieses Virus war für uns besonders interessant, da bei diesen Infektionen ein eindeutiger und nach wie vor ungedeckter medizinischer Bedarf besteht und es bislang weder eine direkte Therapie noch einen wirksamen Impfstoff dagegen gibt.“ Die Forschung wurde im Rahmen der Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen(öffnet in neuem Fenster) gefördert und von Giulio Nannetti, einem Einzelstipendiaten(öffnet in neuem Fenster) des Programms, durchgeführt.
Höchst ermutigende Ergebnisse
Das Team um Brancale, das mit Forschenden von der Universität Padua(öffnet in neuem Fenster) zusammenarbeitete, setzte bei seiner Forschung eine Kombination aus computergestützten Methoden zur Wirkstoffentwicklung, biochemische Werkzeuge sowie zellbasierte antivirale Assays(öffnet in neuem Fenster) ein. Die Forschung in diesem Feld konzentriert sich üblicherweise auf die Entwicklung von traditionellen enzymatischen Inhibitoren(öffnet in neuem Fenster). Dieses Projekt ging hier einen anderen Weg, indem es seinen Blick auf ein ungewöhnliches virales Ziel richtete: die Schnittstelle zwischen viralen Proteinen. „Das Abzielen auf eine Protein-Protein-Interaktion(öffnet in neuem Fenster) ist als Methode der Krebsbekämpfung zwar bereits weithin etabliert, als Möglichkeit zur Entwicklung von antiviralen Verbindungen jedoch nach wie vor kaum erforscht“, erklärt Brancale. „Somit stellt unser Projekt einen der ersten Versuche überhaupt dar, eine Verbindung gegen das Denguefieber zu entwickeln, die auf eine Protein-Protein-Interaktion abzielt.“ Durch diese Arbeit konnte das FINDER-Team eine Gruppe potenzieller Wirkmoleküle („Hits“) identifizieren, die in der Lage sind, durch zielgerichtetes Angreifen einer Protein-Protein-Interaktion eine antivirale Wirkung gegen DENV zu entfalten. „Diese Ergebnisse sind äußerst ermutigend und werden unsere weitere Arbeit erheblich unterstützen“, fügt Brancale hinzu.
Die Arbeit geht weiter
Das FINDER-Projekt ist zwar inzwischen abgeschlossen, doch seine Arbeit wird fortgeführt. „Ich glaube, wir sind einzigartig aufgestellt, um unsere Forschung fortzusetzen und weitere Belege dafür zu finden, dass ein gezielt gegen virale Protein-Protein-Interaktionen gerichteter Ansatz die Entwicklung neuer Virostatika voranbringen kann“, merkt Brancale an. Die Projektforschenden arbeiten derzeit an der Veröffentlichung einiger ihrer ersten Ergebnisse. Diese präsentierten sie jüngst auf mehreren Konferenzen, darunter die Internationale Konferenz für antivirale Forschung(öffnet in neuem Fenster) in Baltimore in den Vereinigten Staaten, der 7. Europäische Kongress für Virologie(öffnet in neuem Fenster) in Rotterdam in den Niederlanden und die vierte Ausgabe der Innovative Approaches for Identification of Antiviral Agents Summer School(öffnet in neuem Fenster) in Cagliari, Italien. Ferner erforschen sie die Möglichkeit, bestimmte Verbindungen, auch mit Blick auf eine mögliche Kommerzialisierung, weiterzuentwickeln.