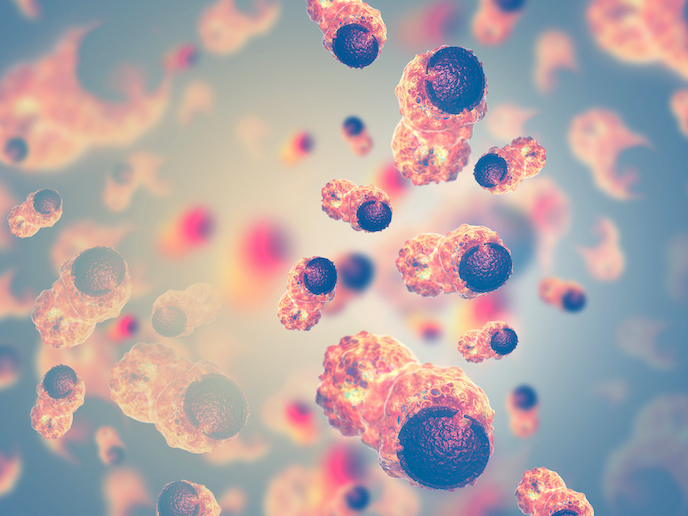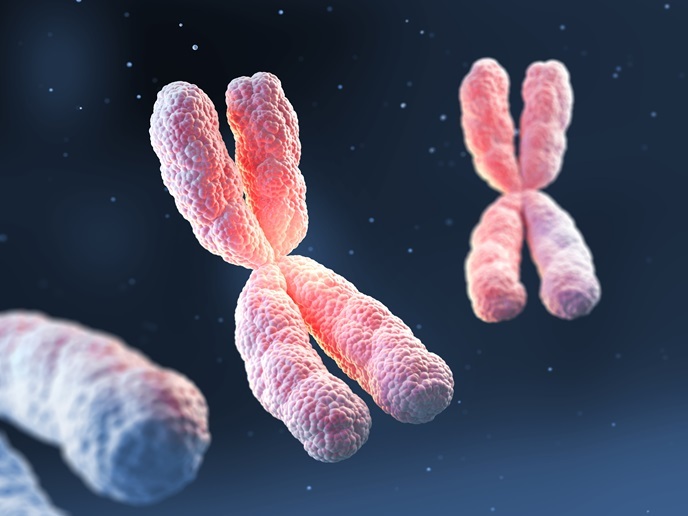Schadensprävention hat Vorrang: Nebenwirkungen von Krebsbehandlungen mindern
Die gängigsten Krebsbehandlungen beinhalten tendenziell eine chirurgische Tumorentfernung in Kombination mit Therapien zur Abtötung metastasierender Zellen(öffnet in neuem Fenster) (krebserregende Zellen, die in andere Körperregionen streuen). Chemotherapien(öffnet in neuem Fenster) werden beispielsweise häufig vor einem chirurgischen Eingriff angewandt, um die Tumorgröße zu verringern und nach einem chirurgischen Eingriff, um die potenzielle Metastasenbildung zu verringern. Therapien wie eine Chemotherapie sollen den Zelltod herbeiführen. Doch bei manchen Patientinnen und Patienten können therapieresistente Zellen überleben, was potenziell zu einem Tumorrezidiv führt. „Die Therapien und Verfahren selbst können das Milieu der überlebenden Tumorzellen beeinflussen“, erklärt Cancer-Recurrence-Projektkoordinator Jacco van Rheenen(öffnet in neuem Fenster) vom Niederländischen Krebsinstitut (NKI)(öffnet in neuem Fenster). „Ich wollte verschiedene unerwünschte Nebenwirkungen von Therapien untersuchen, um zu sehen, wie wir das Tumorrezidiv verringern könnten. Dies könnte neue therapeutische Wege bahnen, die für ein breites Spektrum von Krebsbehandlungen zu besseren Ergebnissen führen.“
Unerwünschte Nebenwirkungen
Das Projekt Cancer-Recurrence, das vom Europäischen Forschungsrat(öffnet in neuem Fenster) unterstützt wurde, begann mit der Durchführung einer Retrospektivstudie zu Patientinnen und Patienten, die Biopsien (Entfernung von Gewebeproben) unterzogen worden waren. Zudem wurde eine intravitale Bildgebung(öffnet in neuem Fenster), eine Form von Mikroskopie, durchgeführt, welche die hochauflösende Beobachtung biologischer Prozesse ermöglicht. „Wir entwickelten neue Mausmodelle, intravitale Bildgebungsinstrumente und Einzelzellsequenzierungsansätze, um zu untersuchen, ob sich die Zusammensetzung oder Merkmale überlebender Krebszellen verändern“, merkt van Rheenen an. „Wir verwendeten diese Instrumente dann, um zu erforschen, wie diese Zellen in distale Regionen migrieren und möglicherweise das erneute Tumorwachstum induzieren.“ Es wurden verschiedene unerwünschte Nebenwirkungen bei der Durchführung von Biopsien festgestellt. „Unsere Studien legten nahe, dass Nadelbiopsien eine Entzündungsreaktion auslösen können“, sagt van Rheenen. „Dies kann zu einem anschließenden Anstieg der Proliferation und Migration überlebender Krebszellen führen.“ Genauer gesagt waren van Rheenen und sein Team in der Lage, zu zeigen, wie sich bestimmte Zellen durch die Rekrutierung von Makrophagen – spezialisierte Zellen, die an der Detektion und Vernichtung schädlicher Organismen beteiligt sind – fortbewegen und vermehren konnten. Das Cancer-Recurrence-Projekt ließ die Schlussfolgerung zu, dass durch die Hemmung der Makrophagenrekrutierung der klinische Nutzen von chirurgischen Eingriffen und Biopsien verbessert werden kann. Die Verabreichung von Dexamethason – ein gemeinhin zur Behandlung von Entzündungen eingesetztes Steroid – zeigte aufgrund einer Biopsie bei Mäusen sowie Patientinnen und Patienten, dass die beobachtete Entzündungsreaktion und das anschließende Tumorwachstum unterdrückt werden konnten.
Neue Behandlungsansätze
Die Projektergebnisse eröffnen neue Ansätze für die Tumorbehandlung, die mehr auf die Patientinnen und Patienten anstatt die Erkrankung fokussiert sind. „Obwohl die Patientinnen und Patienten häufig mit dem gleichen Behandlungsplan behandelt werden, wissen wir, dass Therapien häufig nur für eine geringe Anzahl von Patientinnen und Patienten von Nutzen sind“, sagt van Rheenen. „Dies bedeutet, dass wir viele Patientinnen und Patienten mit unerwünschten Nebenwirkungen überbehandeln.“ Der nächste Schritt für van Rheenen und sein Team besteht in der Ermittlung von Patientinnen und Patienten, denen bestimmte Behandlungen wie beispielsweise Chemotherapien am meisten nutzen und die Behandlung von Patientinnen und Patienten einzustellen, wenn diese nicht anschlägt. „Dies erfordert die Identifikation guter Biomarker“, merkt er an. „Hierzu beabsichtigen wir die Forschung fortzuführen, um nach verschiedenen Behandlungs- und Krebsarten zu suchen.“ Der Erfolg des Projekts Cancer-Recurrence ermöglichte van Rheenen die Einrichtung einer neuen Forschungslinie in seinem Labor, die auf unerwünschte Nebenwirkungen ausgerichtet ist. „Dies ist wichtig, da ‚Primum non nocere‘, d. h. ‚erstens nicht schaden‘, einer der ersten Grundsätze ist, die Ärztinnen und Ärzte während ihres Studiums lernen“, lautet sein Fazit.