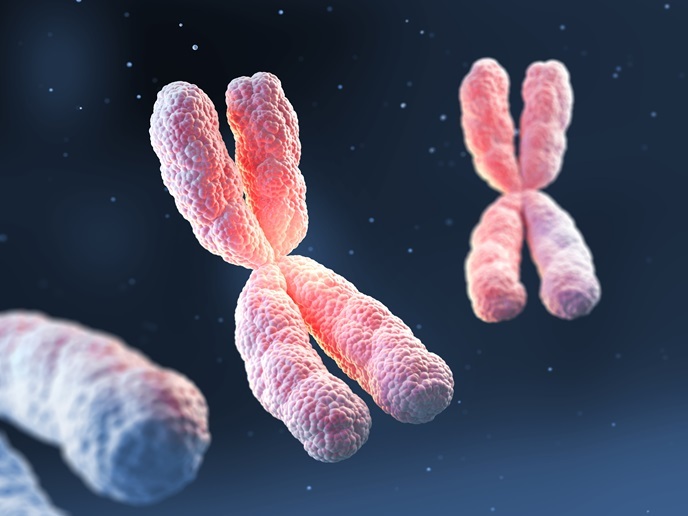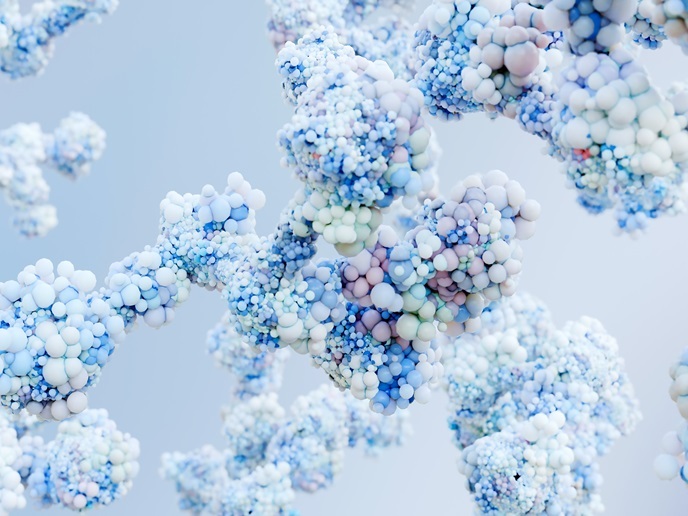Aminosäureanalyse offenbart prähistorische Ernährungsgewohnheiten
Die Biologie kann die globale Ausbreitung von Organismen und die Struktur von Ökosystemen, wie wir sie heute kennen, noch immer nicht vollständig erklären. „Nehmen wir den Amazonas-Regenwald“, sagt Julia Tejada, Projektstipendiatin von FEPS(öffnet in neuem Fenster), die gegenwärtig am California Institute of Technology(öffnet in neuem Fenster) in den USA tätig ist. „Es ist die vielfältigste kontinentale Region, die noch vor 10 000 Jahren von Riesenfaultieren, nashornähnlichen Huftieren, Mastodonten, Riesenvögeln und weiteren, heute ausgestorbenen Tieren bewohnt war.“
Prähistorisches Leben in Südamerika neu bewerten
Im Rahmen des von der Universität Cambridge(öffnet in neuem Fenster) im Vereinigten Königreich koordinierten Projekts FEPS sollte neu bewertet werden, wie die südamerikanischen Ökosysteme vor dem letzten eiszeitlichen Aussterben wirklich aussahen. „Die Entdeckung, dass fossile Faultiere über eine andere Ökologie als bisher angenommen verfügten, könnte unser Verständnis dieser Gemeinschaften radikal verändern“, erklärt Tejada. Das Ziel des im Rahmen der Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen(öffnet in neuem Fenster) unterstützten Projekts war, direkte Beweise für die Ernährung dieser ausgestorbenen Tiere zu sammeln, anstatt sich auf indirekte Indikatoren wie Schädel- oder Zahnformen zu verlassen. „Wir haben Isotopenanalysen von Aminosäuren durchgeführt“, erklärt Tejada. „Dadurch erlangten wir direkte Informationen über das Ernährungsverhalten und konnten beurteilen, ob pflanzliche oder tierische Proteine verzehrt wurden.“ Um diese Proben zu sammeln, besuchte Tejada paläontologische Sammlungen in aller Welt. „Fossilien weisen oft einen geringen oder gar keinen Kollagengehalt auf. Je älter das Fossil ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass es organische Verbindungen enthält“, sagt Tejada. „Außerdem beinhalten sie oft organische Verbindungen aus dem Boden, die nur schwer zu entfernen sind. Deshalb mussten wir unseren Ansatz verändern, und dabei viel nach der Versuch-und-Irrtum-Methode vorgehen.“ Nachdem die Proteine isoliert und extrahiert waren, wurde eine Reihe chemischer Verfahren durchgeführt, um das Protein in seine einzelnen Aminosäuren aufzuspalten. „Geduld und Ausdauer sind bei geochemischen Experimenten oft entscheidend für den Erfolg“, fügt Tejada hinzu.
Neue Analyseverfahren validieren
Ein Großteil dieser Analyse ist noch nicht abgeschlossen, aber einige vorläufige Ergebnisse liegen bereits vor. „Wir haben festgestellt, dass einige Aspekte südamerikanischer Säugetiergemeinschaften komplexer sind, als wir ursprünglich dachten, und dass sich ihr Ernährungsverhalten vielseitiger als erwartet gestaltet“, bemerkt Tejada. Diese ersten Ergebnisse haben dazu beigetragen, die im Zuge des Projekts angewandten Analyseverfahren zu validieren, mit denen sich bestimmte biologische Merkmale wie zum Beispiel Ernährungsvorlieben direkt nachweisen lassen. Früher wurden die Proben anhand von Stickstoffisotopendaten(öffnet in neuem Fenster) bewertet, die jedoch Tejada zufolge bestenfalls ungenau und schlimmstenfalls irreführend sein können. Auch das bloße Studium indirekter Indikatoren wie Schädel- oder Zahnformen kann der Wissenschaft nur wenig darüber verraten, wie ein Tier lebt und zu was es in der Lage ist.
Rolle der Ernährung bei Krankheiten entdecken
Tejada plant, auf dieser ersten Arbeit aufzubauen und zu prüfen, ob mit weiteren gewonnenen Aminosäuren Vorhersagen über biologische Merkmale getroffen werden können. „Zudem gehen wir über die Nutzung von Aminosäuren aus Kollagen und Keratin hinaus und wenden uns anderen Arten von Proteinen zu, die möglicherweise länger haltbar sind“, erklärt sie. Die in diesem Projekt eingesetzten Verfahren könnten auch über die paläoökologische Forschung hinaus Anwendung finden. „Wir stellen uns Anwendungen in Bereichen wie etwa der Rolle der Ernährung bei Krankheiten vor“, fügt Tejada hinzu. „Unser Verfahren könnte dazu beitragen, die Aminosäuresynthese und die verschiedenen Stoffwechselpfade zu verfolgen, die unter verschiedenen natürlichen und pathologischen Bedingungen genutzt werden. Selbst unter kontrollierten Fütterungsbedingungen wie sie in Zoos gegeben sind, wissen wir zwar, was wir den Tieren zu fressen geben und in welchem Verhältnis, aber wir wissen nicht genau, was das Tier wirklich zu sich nimmt und wie diese Tiere Proteine verstoffwechseln.“