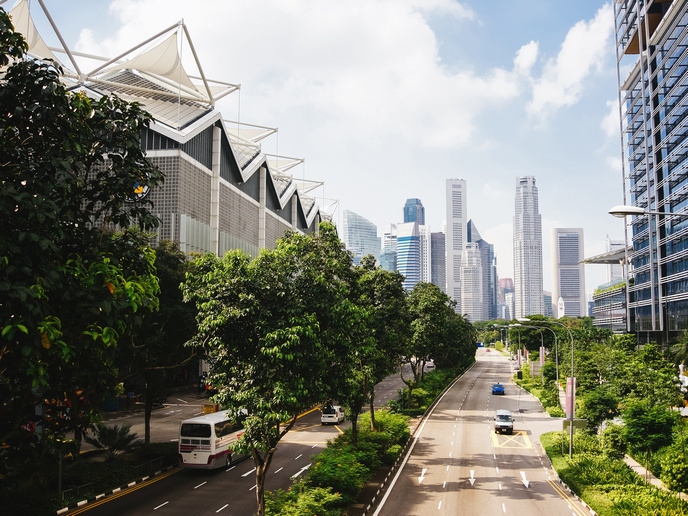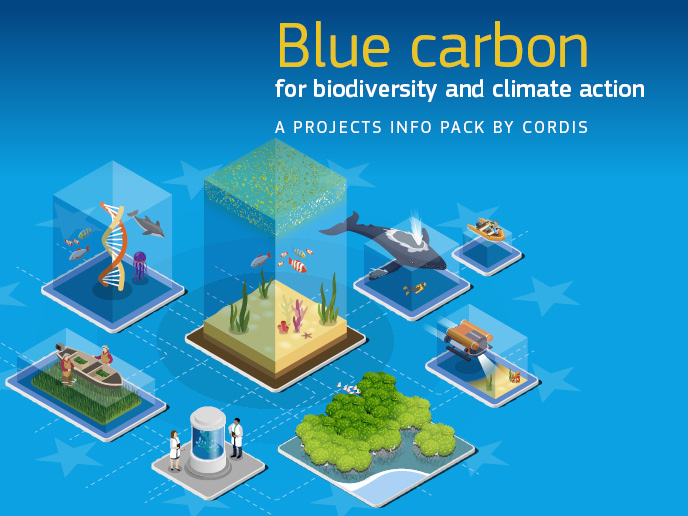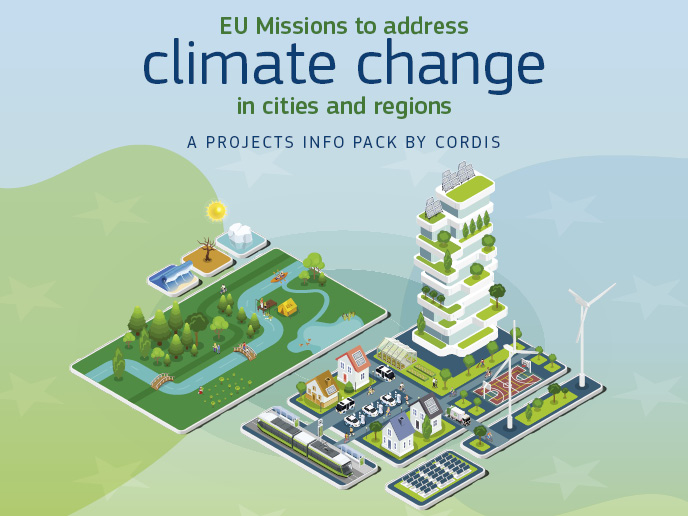Seetangvorkommen als Hotspots der Plastikverschmutzung
Plastikmüll und Abfälle im Meer sind leider ebenso wie Sand und Algen Teil des Küstenökosystems. Ein Strandspaziergang könnte jedoch zu der Annahme verleiten, dass Algen Kunststoffe einfangen und verhindern, dass es die umgebende Umwelt weiter verschmutzt. Doch der Schein kann trügen. Laut Angaben des Teams des EU-finanzierten Projekts SCRAP bleibt zwar Plastikmüll in den Seetangbänken hängen, aber dabei handelt es sich nur um die halbe Wahrheit. Im Rahmen des Projekts wurden bei Feldforschung Proben von verschiedenen Algenarten und dem darunter befindlichen Sand genommen und alle Kunststoffpartikel entfernt, die sich in den Wedeln verfangen hatten. Durch den Vergleich dieser Proben mit dem puren Sand in der Nähe konnten die Forschenden feststellen, ob der Seetang den Müll hauptsächlich festhält oder dazu beiträgt, dass er in die Sedimente gelangt. „Anhand des Vergleichs von bewachsenem und unbewachsenem Sand konnten wir herausfinden, ob die Algen eher wie eine klebrige Falle oder wie ein Transportweg für die Verlagerung von Kunststoffen in die Sedimente wirken“, sagt Hoi Shing Lo, Forscher an der Universität Stockholm(öffnet in neuem Fenster), der koordinierenden Projektpartnerin. Es stellte sich heraus, dass Seetangvorkommen als Hotspots der Plastikverschmutzung fungieren. „In diesen Unterwasserwäldern sammeln sich Kunststoffe an, die sich zwischen den Wedeln verfangen und im Sand darunter absetzen“, fügt Lo hinzu.
Mikroplastik verschärft das Problem
An dieser Stelle wird es ziemlich problematisch. „Das Problem ist dabei nicht so sehr die physische Präsenz von Kunststoffen, sondern sind vielmehr die aus ihnen herausgelösten Chemikalien und weitere Umweltfaktoren wie Schwebeteilchen und Biofilme“, erklärt Lo. Zur Veranschaulichung wurde im Verlauf des Projekts die Sedimentresuspension untersucht, bei der Schlamm und Sand aufgewirbelt werden, was bei Stürmen, Baggerarbeiten oder sogar durch den Betrieb von Schiffsschrauben sehr häufig geschieht. Wenn diese feinen Partikel in die Wassersäule aufsteigen, transportieren sie Nähr- und Schadstoffe, die ansonsten eingeschlossen blieben. Bei ihren sowohl vor Ort als auch im Labor durchgeführten Experimenten stellten die Forschenden fest, dass durch die Zugabe von Mikroplastik die Suspension länger hält und dichter bleibt. Daraus schlossen die Forschenden, dass zusätzliche Turbulenzen mehr sedimentgebundene Schadstoffe freisetzten, die Klarheit des Wassers verringerten und einen stärkeren chemischen Impuls erzeugten, der die Algen belasten kann. „Mit anderen Worten: Mikroplastik erhöht nicht nur die Menge des aufgewirbelten Schlamms im Wasser, sondern verstärkt die gesamte Störung und vervielfacht ihre ökologischen Folgen“, erläutert Lo.
Warum, wie und wo Plastikverschmutzung überwachen
Diese Ergebnisse sind bedeutsam, denn sie zeigen, dass die Auswirkungen der Plastikverschmutzung im Kontext der realen Umwelt behandelt werden sollten. „Es geht nicht nur um den sichtbaren Abfall, sondern auch um chemische Ausschwemmungen und Biofilme, die wichtige ökologische Prozesse wie Photosynthese, Nährstoffkreisläufe und die Regulierung des Algenwachstums beeinträchtigen können“, erklärt Lo. Seetangvorkommen, die oft wahre Hotspots der biologischen Vielfalt sind, erweisen sich als besonders gefährdet. Laut Lo bedeutet dies, dass Umweltbehörden, Küstenmanagement und alle, deren Arbeit Meereslebensräume betrifft, überdenken müssen, warum, wie und wo sie die Plastikverschmutzung überwachen sollten. „Vegetative Lebensräume sind nicht nur Kunststoff-Brennpunkte, sondern können auch wichtige Verbündete sein, da sie natürliche Dienstleistungen anbieten, die dazu beitragen können, Plastikmüll abzufangen, zurückzuhalten und sogar abzubauen“, schließt Lo. Die Forschungsergebnisse des Projekts werden in einer Titelstory der kommenden Ausgabe der Fachzeitschrift „ACS Environmental Au“(öffnet in neuem Fenster) vorgestellt. Das Projekt SCRAP wurde innerhalb der Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen(öffnet in neuem Fenster) unterstützt.