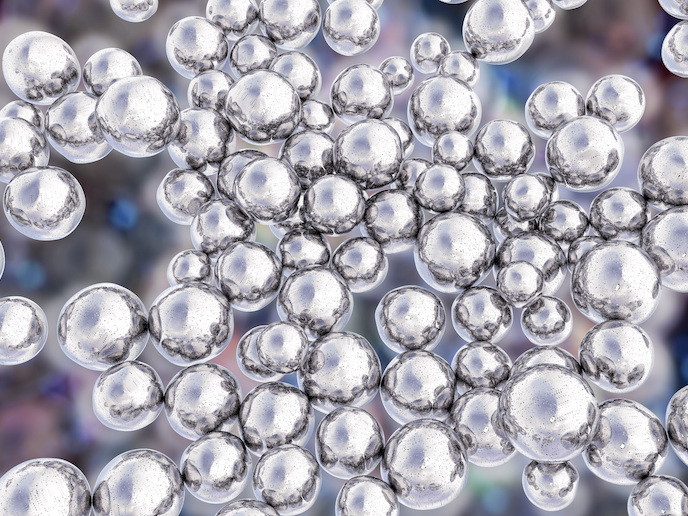Bauxitrückstand in wertvolle Ressourcen umwandeln
Der bei der Verarbeitung von Bauxit anfallende Bauxitrückstand bzw. Rotschlamm ist das wichtigste Nebenprodukt der Gewinnung von Aluminiumoxid. Allein in der EU werden jährlich mehr als sieben Millionen Tonnen Bauxitrückstand erzeugt, aber weniger als 100 000 Tonnen davon werden recycelt. Der größte Teil des Rotschlamms wird auf Deponien gelagert, da es gegenwärtig keine großmaßstäbliche, nachhaltige Weiterverwendungsmöglichkeit gibt.
Win-Win-Szenario für europäische Aluminium- und Zementindustrie
Da konventionelle zementartige Zusatzstoffe(öffnet in neuem Fenster) wie Flugasche und Hüttensand immer knapper werden, sucht der Zementsektor nach Alternativen wie zum Beispiel Bauxitrückstand. Die europaweite Verfügbarkeit von Bauxitrückstand und die Nähe der Aluminiumoxidanlagen zu Zementwerken bieten eine vielversprechende Gelegenheit für Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft mithilfe von Industriesymbiose, bei der ungenutzte oder übrigbleibende Ressourcen eines Unternehmens von einem anderen genutzt werden. Im Rahmen des EU-finanzierten Projekts ReActiv(öffnet in neuem Fenster) wurde eine symbiotische Wertschöpfungskette zwischen Zementwerken und Aluminiumoxidraffinerien aufgebaut, wobei die Umwandlung von Bauxitrückstand in einen neuen, für Zementanwendungen geeigneten zementartigen Zusatzstoff demonstriert wurde. Er ersetzt außerdem bis zu 30 % des Klinkers, des Hauptbestandteils von Zement, bei der Zementherstellung.
Wahrnehmung von Rotschlamm neu definieren
„Mit der Arbeit von ReActiv wird ein reichlich vorhandener industrieller Rückstand in eine wertvolle Ressource umgewandelt und auf diese Weise eine echte Industriesymbiose in Gang gesetzt“, erklärt Philippe Bénard, FuE-Projektleiter bei Holcim Innovation Center(öffnet in neuem Fenster), dem das Projekt koordinierenden Schweizer Unternehmen. Um diese Ziele zu erreichen, wendeten die Forschenden drei verschiedene Verarbeitungsverfahren an: thermische Aktivierung des Bauxitrückstands mit Kaolinit-Ton (Kokalzinierungsprozess), karbothermische Verglasung des Bauxitrückstands zur Erzeugung eines eisenreichen zementartigen Zusatzstoffs (Verglasungsprozess) und reduktives Schmelzen des Bauxitrückstands zur Herstellung eines eisenfreien zementartigen Zusatzstoffs (Schmelzprozess). Die Projektpartner demonstrierten insbesondere den direkten Einsatz von Rotschlamm bei zwei neuen alternativen Zementprodukten. Beim ersten handelte es sich um einen neuartigen Kalziumsulfoaluminat-Ferrit-Klinker, bei dem 35 % Bauxitrückstand als Rohmaterial genutzt werden. Die drei Demonstratoren sind jetzt aufgestellt und befinden sich im Betrieb.
Replizierbare Technologie reduziert CO2-Emissionen
Die technologische Lösung kann in der Aluminiumoxid- und Zementindustrie, aber auch bei der Verwertung von Nebenprodukten weiterer Industriezweige nachgeahmt und eingesetzt werden. Sie verfügt außerdem über das Potenzial, das Abwasser zu reduzieren. „ReActiv lässt den früher als Industrieabfall geltenden Rotschlamm zu einem Eckpfeiler für Europas nächste Generation zementartiger Zusatzstoffe bei der Entwicklung CO2-armer Zementprodukte werden“, fügt Bénard hinzu. „Dieser bahnbrechende Ansatz verwandelt eine Umweltbelastung in eine industrielle Chance, wobei der Zugang zu einer neuen Klasse von hochleistungsfähigen zementartigen Zusatzstoffen erschlossen wird.“ Auf der Grundlage einer Lebenszyklusanalyse wurde das auf einen Zeitraum von einhundert Jahren bezogene Treibhauspotenzial(öffnet in neuem Fenster) für die zementartigen Zusatzstoffe auf 200 kg CO2/t für kokalzinierten Bauxitrückstand, auf 440 kg CO2/t für verglasten Bauxitrückstand und auf 470 kg CO2/t für geschmolzenen Bauxitrückstand geschätzt. Als wichtige Minderungsstrategien zur weiteren Verkleinerung des CO2-Fußabdrucks der zementartigen Zusatzstoffe wurden die Verarbeitungsverfahren mit grüner Energie statt mit fossilen Brennstoffen elektrifiziert und fossiler Kohlenstoff durch Biokohle als Reduktionsmittel ersetzt. „ReActiv ist ein Beispiel für ein transformatives Modell der sektorübergreifenden Zusammenarbeit, der dem Kreislaufprinzip entsprechenden Innovation und systemischen Integration. Es werden industrielle Wertschöpfungsketten neu belebt, die Bodennutzung durch minimierte Abfalllagerung optimiert und qualifizierte Arbeitskräfte für den grünen Wandel ausgebildet“, fasst Bénard abschließend zusammen. „Die Projektergebnisse stehen im Einklang mit dem Deal für eine saubere Industrie der EU und tragen zur nachhaltigeren Zukunft Europas bei.“