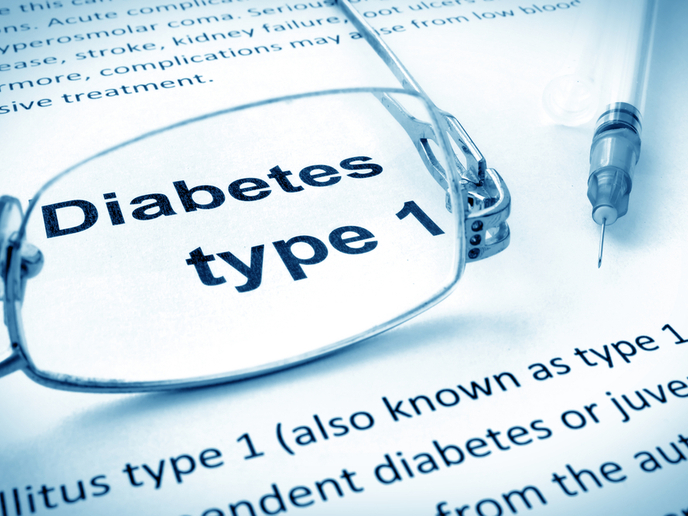Neue bionische Geräte vereinen Biologie und Elektronik
Integrierte bionische Geräte wie Cochlea-Ohrimplantate und bionische Augen sollen natürliche Körperfunktionen ersetzen oder ergänzen. Ein großes Problem stellt jedoch die nach wie vor bestehende stark „mechanische“ Beschaffenheit der vorhandenen bionischen Schnittstellen im Vergleich zu menschlichem Gewebe dar. „Die Verwendung herkömmlicher Metalle und starrer Polymere kann Entzündungen und Narbenbildung hervorrufen, was im Laufe der Zeit mit einer Verschlechterung der Leistung einhergeht“, erklärt die Projektkoordinatorin von Living Bionics Rylie Green(öffnet in neuem Fenster) vom Imperial College(öffnet in neuem Fenster) im Vereinigten Königreich. „Schon kleinste Bewegungen können Mikroschäden verursachen.“ Viele bionische Geräte sind außerdem chemisch inert, was bedeutet, dass sie nicht aktiv mit der biologischen Umgebung kommunizieren oder sich an diese anpassen. Dieser Mangel an Integration ist der Grund dafür, dass die Leistung der Geräte nach Monaten oder Jahren im Körper üblicherweise nachlässt.
Vereinigung von Biologie und Elektronik
Das Ziel des mit Unterstützung durch den Europäischen Forschungsrat(öffnet in neuem Fenster) finanzierten Projekts Living Bionics bestand darin, eine neue Denkweise hinsichtlich der Vereinigung von Biologie und Elektronik herbeizuführen, und Schnittstellen zu schaffen, die für den Körper nicht nur verträglich sind, sondern zu einem Teil von ihm werden. „Wir wollten ‚lebende Elektroden‘ entwickeln, die weiche, leitfähige Werkstoffe mit biologischen Komponenten kombinieren, die sich direkt in Zellen und Gewebe integrieren lassen“, sagt Green. „Im Wesentlichen streben wir eine Abkehr von harten Implantaten an, um uns auf adaptive, regenerative Systeme zu konzentrieren, die sich mit dem Körper weiterentwickeln.“ Um dies zu erreichen, richtete das Projekt das Augenmerk auf die Entwicklung biohybrider Werkstoffe. Dazu gehören beispielsweise Hydrogele, Elastomere und modifizierte Werkstoffe, die körpereigene Komponenten, insbesondere solche aus dem Gehirn, enthalten. Diese Werkstoffe sind so weich und flexibel wie Gewebe, können aber dennoch elektrische Signale effizient übertragen. „Die Kombination aus Stammzellen und den Signalen, die für die Produktion gesunden Nervengewebes im Gerät erforderlich sind, war ein weiteres entscheidendes Element“, merkt Green an.
Der Weg zu echten „lebenden Elektroden“
Das Projektteam erstellte 3D-Modelle von Nervengewebe, um zu untersuchen, wie Zellen mit unterschiedlichen chemischen Werkstoffzusammensetzungen interagieren, und führte elektrische und mechanische Leistungsbewertungen durch. Diese Tests halfen dabei, die Aufrechterhaltung der Leitfähigkeit und Zelllebensfähigkeit über lange Zeiträume bei Verwendung bestimmter neuartiger Werkstoffe aufzuzeigen. Das Team konnte beachtlicherweise zeigen, dass es möglich ist, Kombinationen aus Werkstoffen und Zellen an der Schnittstelle eines bionischen Geräts anzubringen und natürliche Zellverbindungen mit angrenzendem Hirngewebe(öffnet in neuem Fenster) herzustellen. Ein weiterer wichtiger Durchbruch war ein Verständnis davon, wie die physikochemischen Eigenschaften bestimmter Polymere und Hydrogele die Zellhaftung und Langzeitfunktion beeinflussen. „In konzeptioneller Hinsicht haben wir einen Weg hin zu echten ‚lebenden Elektroden‘ geebnet, bei denen künstlich hergestellte Zellen auf kontrollierte und stabile Weise mit Wirtsneuronen interagieren können“, erklärt Green. „Wir haben gezeigt, dass dies nicht nur in einer Petrischale, sondern auch im Gehirn eines lebenden Nagetiers funktioniert.“
Neue regenerative bioelektronische Therapien
Zu den nächsten Schritten gehört eine noch gründlichere Validierung dieser Systeme in Tiermodellen, um die langfristige Biokompatibilität und Signalstabilität zu bestätigen. Die Herstellungsverfahren müssen noch weiter verfeinert werden, damit die Werkstoffe für den Einsatz in der klinischen Praxis skaliert und sterilisiert werden können. „Die Zusammenarbeit mit Industriepartnern wird der Schlüssel zur Bewältigung der regulatorischen Anforderungen und zum Erreichen früher menschlicher Machbarkeitsstudien sein“, fügt Green hinzu. Langfristig hoffen Green und ihr Team, dass diese Arbeit den Begriff „medizinisches Implantat“ neu definieren kann. „Statt inerter Metallkomponenten, deren Zustand sich mit der Zeit verschlechtert, stellen wir uns lebende, adaptive Systeme vor, die mit dem Körper heilen und ihre Funktionen auf natürlichere Weise wiederherstellen“, sagt sie. „Dies würde die Tür zu einer neuen Generation regenerativer bioelektronischer Therapien öffnen, bei denen die Grenze zwischen Gerät und Gewebe quasi verschwimmt.“