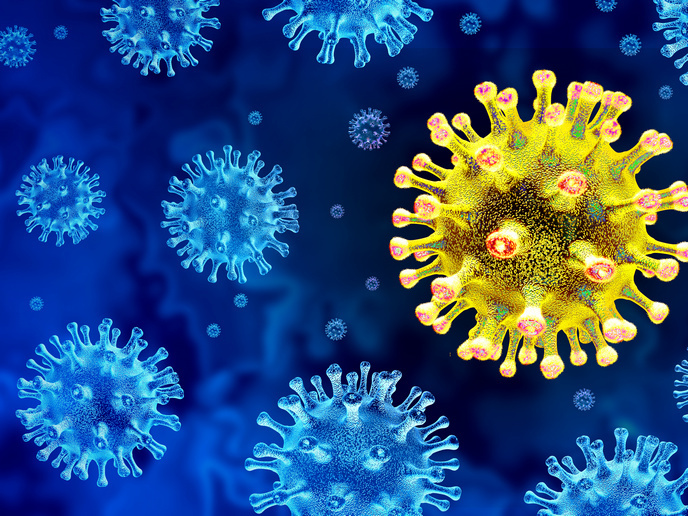Nutzen der Immuntherapie für Krebserkrankte ausweiten
Die Immuncheckpoint-Blockade gilt als eine revolutionäre Krebstherapie, bei der Wirkstoffe zur Blockierung von Proteinen, den sogenannten Immuncheckpoints, zum Einsatz kommen. Diese Checkpoints halten Immunzellen davon ab, sich gezielt gegen Krebsgewebe zu richten. Ungeachtet der guten Ergebnisse profitiert jedoch nur ein kleiner Prozentsatz der an Krebs Erkrankten von der Therapie. Die Immuncheckpoint-Blockade wirkt im Allgemeinen nur bei Tumoren, die für das Immunsystem sehr gut sichtbar sind, wie es etwa bei Lungenkrebs bei Raucherinnen und Rauchern sowie bei durch UV-Bestrahlung verursachten Melanomen der Fall ist. Der Mechanismus der Immuncheckpoint-Blockade besteht darin, zuvor aktivierte T-Zellen zu retten oder die T-Zell-Antworten zu verstärken. Theoretisch können diese Therapien jedoch auf alle T-Zellen im Körper ausgerichtet werden, auch auf diejenigen, die auf Viren reagieren. „Dieser Mangel an Selektivität bildet den Grund, warum die Behandlung mit Immuncheckpoint-Blockade oft mit dem Immunsystem zusammenhängende Nebenwirkungen auslöst“, erklärt Noel de Miranda(öffnet in neuem Fenster), außerordentlicher Professor für Krebsimmungenomik am Medizinischen Zentrum der Universität Leiden(öffnet in neuem Fenster). „Leider können wir gegenwärtig nicht zuverlässig vorhersagen, ob mit der Immuncheckpoint-Blockade bei einer bestimmten Person in erster Linie tumorspezifische T-Zellen verstärkt oder andere T-Zell-Populationen beeinflusst werden“, fügt er hinzu. Im Rahmen des vom Europäischen Forschungsrat(öffnet in neuem Fenster) finanzierten Projekts RARITY verfolgten die Forschenden unter Leitung von de Miranda das Ziel der Entwicklung von Strategien, welche die Aktivität der Immuncheckpoint-Blockade ergänzen, um den Nutzen der Immuntherapie auf eine breitere Patientenpopulation auszuweiten. „Das kann als eine Erweiterung des Werkzeugkastens der Immuntherapie betrachtet werden, was besonders bei Krebsarten wichtig ist, die nicht auf die Therapie mit Immuncheckpoint-Blockade ansprechen“, betont de Miranda.
Krebsreaktive Immunzellen finden
Im Zuge des Projekts RARITY kombinierten die Forschenden Grundlagenforschung (präklinisch) und translationale Forschung, wobei Daten und Proben aus klinischen Studien zum Einsatz kamen. Zunächst untersuchte das Team, ob spezifische Marker krebsspezifische T-Zellen anzeigen, die dann als therapeutische Produkte eingesetzt werden könnten. In Zusammenarbeit mit klinischen Partnern versuchten die Forschenden außerdem, neue zelluläre Effektoren für das Ansprechen auf Immuntherapie zu ermitteln. Dazu wurden Proben von mit Immuncheckpoint-Blockade behandelten Erkrankten analysiert. „Dieser bidirektionale Austausch zwischen Labor und Klinik bildet das ideale Forschungsumfeld für unsere Forschungsgruppe“, bekräftigt de Miranda.
Beitrag zu innovativen und alternativen Immuntherapien
Das Team von RARITY hat erfolgreich vorgeführt, dass auch bei Patientinnen und Patienten, die derzeit nicht von der Checkpoint-Blockade-Immuntherapie profitieren, tumorspezifische T-Zellen vorhanden sind. „Dieses Ergebnis ist signifikant, denn es deutet darauf hin, dass diese Betroffenen einer Tages mit einer Immuntherapie behandelt werden könnten, sobald der optimale Ansatz zur Nutzung dieser Zellen gefunden ist“, erklärt de Miranda. Das Team wies außerdem nach, dass tumorspezifische T-Zellen von anderen T-Zellen unterschieden werden können, woraus sich die Möglichkeit eröffnet, sie gezielt zu isolieren und in der Immuntherapie einzusetzen. Im Zuge von RARITY wurde gleichermaßen die Bedeutung weniger bekannter Immunzelluntergruppen hervorgehoben sowie deren Funktion in Bezug auf Immunantworten von Personen aufgezeigt, die sich einer Checkpoint-Blockade-Immuntherapie unterziehen. Während sich die meisten Forschungsarbeiten im Immuntherapiebereich traditionell auf konventionelle T-Zellen konzentrierten, eröffnen sich hier alternative Zugänge zu Therapien zur Beseitigung von Krebszellen. Zu guter Letzt trug RARITY zur Entwicklung zahlreicher technologischer Ansätze bei, die derzeit in de Mirandas Labor im Einsatz sind und völlig neue Einblicke in die Krebsbiologie und die Wechselwirkungen zwischen Krebszellen und Immunzellen gestatten. „Diese Technologien versetzen uns in eine privilegierte Position, jene Mechanismen entschlüsseln zu können, die dem therapeutischen Ansprechen der Patientinnen und Patienten zugrunde liegen, was letztlich zur Konzipierung neuartiger Strategien in Richtung optimierte Behandlungswirksamkeit führt“, fügt de Miranda hinzu.
Wissen über Krebsbiologie vertiefen
Die Arbeit im Rahmen von RARITY wird in de Mirandas Labor fortgesetzt, um die Entwicklung neuartiger Immuntherapien zu unterstützen und die Mechanismen des Ansprechens bei sich einer Immuntherapie unterziehenden Menschen zu untersuchen. „Zudem setzen wir weiterhin fortgeschrittene Technologien ein, um unser Verständnis der Krebsbiologie zu vertiefen“, berichtet de Miranda.