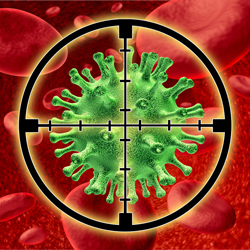Feature Stories - Supercomputer nehmen HIV ins Visier
Und diese Forschung ist im wahrsten Sinne lebenswichtig. AIDS - die erworbene Immunabwehrschwäche - hat zwischen 1981, als man sie erstmals beim Namen nennen konnte, und 2005 mehr als 25 Millionen Menschen getötet und wird damit als eine der verheerendsten Pandemien überhaupt in die Geschichtsbücher der Menschheit eingehen. In der Medizinwissenschaft braucht man dringend neue Ansätze zum Kampf gegen das Virus; die Forschungsarbeit birgt enorme Herausforderungen. DEISA(öffnet in neuem Fenster) ("Distributed European infrastructure for supercomputing applications") konnte die Forscher wirkungsvoll bei der Entwicklung molekularer Simulationen von HIV-Mechanismen unterstützen. Im Verlauf von fünf Jahren und über zwei Projekte hinweg verband DEISA die leistungsstärksten Hochleistungsrechner Europas durch ein Netzwerk miteinander und entwickelte Software, die den Forschern den Zugang zu und die Ausnutzung dieser massiven Ansammlung von Rechenleistung erleichtert. Man entwickelte überdies Supportdienste, um sicherzustellen, dass die Forscher auch den größtmöglichen Nutzen aus der verfügbaren Ausstattung ziehen können. Im Laufe der Arbeit wurde außerdem die "DEISA extreme computing initiative" (DECI) gegründet, um die wissenschaftliche Spitzenforschung in Europa zu unterstützen - Forschung, die von der enormen Rechenleistung profitieren kann, die DEISA verfügbar gemacht hat. Beispielsweise nutzen Forscher des RNAHIV-Projekts(öffnet in neuem Fenster) die Infrastruktur, um noch besser verstehen zu können, auf welche Weise sich Arzneimittelmoleküle an Ribonukleinsäure (RNA) binden. Die RNA ist - zusammen mit der Desoxyribonukleinsäure (DNA) und Proteinen - eines der Moleküle, die die Grundlage sämtlichen Lebens auf unserem Planeten bilden, und sie lenkt die Proteinbildung. Allerdings zielen die meisten Medikamente gegen HIV eher auf virale Proteine als auf die virale RNA ab. Infolgedessen können sie versagen und das Virus entwickelt Arzneimittelresistenzen. Gegenwärtig mangelt es noch an Wissen darüber, wie die HIV-RNA mit zellulären Proteinen des Menschen interagiert, um die virale Transkription - ein wichtiger Schritt bei der viralen Replikation - zu verstärken. Der Versuch, diese Interaktion zu hemmen, könnte mehr erfolgversprechende Anti-HIV-Medikamente hervorbringen und ein wichtiger Anstoß für die Arzneimittelentwicklung sein. Will man Viren wie HIV, das humane Immunschwächevirus, bekämpfen, so müssen Medikamente entwickelt werden, die sich an eine bestimmte Region der viralen RNA binden. Hierbei handelt es sich um einen Teil des genetischen Codes, die sogenannte TAR-Region (Trans-activating response element). Das Problem dabei ist, dass computergestützte Standardansätze einfach nicht besonders gut für eine genaue Vorhersage geeignet sind, wie oder wo sich Wirkstoffmoleküle an die RNA anlagern werden. Normale Instrumente zur Arzneimittelentwicklung tun sich eher schwer mit dieser Vorgehensweise. "Wenn wir uns auf die Physik konzentrieren, die die Wechselwirkungen steuert, die auftreten, wenn Moleküle aneinander andocken, gewinnen wir gute Einblicke, die bei der Entwicklung RNA-basierter Medikamente helfen könnten", so die Meinung Paolo Carlonis, RNAHIV-Projektkoordinator und Professor für computergestützte Biophysik an der "German Research School for Simulation Sciences", einer gemeinschaftlichen Graduiertenschule der RWTH Aachen und des Forschungszentrums Jülich (FZJ), Deutschland. Die RNAHIV-Projekt startete 2008 und wurde im Jahr 2010 abgeschlossen. Unter seiner Fahne versammelten sich Forscher aus der ganzen Welt: von SISSA/ISAS in Triest, Italien, von der ETH Zürich in der Schweiz, von der Universität Washington in den USA und der Universität Ho-Chi-Minh-Stadt in Vietnam. Im Verlauf der 24 Monate versuchten die Experten, die Dynamik des Anbindungsmechanismus zwischen HIV und RNA zu simulieren. Die Untersuchung dieser Wechselwirkungen ist allerdings ein großes rechnerisches Problem. "Wir hatten es mit mehreren Tausend Atomen zu tun und zur Durchführung der Simulationen muss man wissen, wo sich jedes einzelne hinbewegt, und man muss in der Lage sein, diesen Bewegungen zu folgen", erklärt Professor Carloni. "Das ist etwas, was wirklich viel Rechenleistung erfordert!" Diese extrem komplexen Simulationen seien sehr anspruchsvoll. Allerdings vertritt Professor Carloni die Auffassung, dass diese Methode eine sehr viel strengere Beschreibung des Prozesses, in dessen Verlauf das Medikament an die RNA andockt, ergäbe. "Bei der herkömmlichen Medikamentenentwicklung hat man am Ende nur eine Vorhersage, wo das Medikament anbindet, auf dem Tisch. Man erfährt nichts über die Art und Weise, wie sich das Arzneimittelmolekül zur RNA fortbewegt und sich dort einklinkt," merkt der Professor an. Ein aufregender neuer Ansatz Wie Professor Carloni betont, sei diese Forschungsarbeit überaus nützlich. "Man schlägt hier nicht nur einen neuen Weg zur Medikamentenentwicklung ein. Die von uns entwickelten Methoden können zur Untersuchung jeglicher Art von Reaktion zwischen Proteinen und DNA oder Proteinen und RNA eingesetzt werden. Diese Reaktionstypen finden in einer riesigen Anzahl zellulärer Prozesse statt." Es war ein spannendes Projekt, wie er betont, da Physik und Medizin Hand in Hand gehen mussten, um ein wirklich anspruchsvolles Problem zu lösen. Die Arbeit folgte einem dreistufigen Prozess. Die Forscher begannen, indem sie an ihr theoretisches Wissen über biophysikalische Vorgänge anknüpften und eine Vorhersage aufstellten, wie RNA und Arzneimittel interagieren werden. Sie setzten in einer experimentellen Phase Spektroskopieverfahren ein, um den Wahrheitsgehalt ihrer Vorhersagen zu testen. Die spektroskopischen Daten wurden dann dazu verwendet, die Simulationen der Molekulardynamik mit Fakten zu unterlegen. Die von der EU-finanzierten DEISA-Infrastruktur bereitgestellte Rechenzeit spielte eine überaus wichtige Rolle für den Erfolg des RNAHIV-Projekts. Die Berechnungen des RNAHIV-Forschungsprojekts wurden auf dem Cray-XT4/XT5-System am IT Centre for Science in Finnland durchgeführt. Es gab drei unabhängige Läufe, bei denen jeweils bis zu 256 CPU-Kerne eingesetzt wurden. In den Kern der Produktionsimulationen wurden ungefähr 250.000 CPU-Stunden investiert; die Hardware wurde durch Softwaresupport ergänzt. "Aber die DEISA-Infrastruktur hat mehr bewegt, als lediglich den Zugang zu den Supercomputern zu gewährleisten. Durch die Unterstützung von Projekten wie RNAHIV ermöglicht DEISA außerdem den Einsatz von Hochleistungscomputern für andere Projekte, die im Zusammenhang mit der Gesundheit des Menschen stehen. Und indem es Wissenschaftlern aus einem Entwicklungsland wie Vietnam möglich war sich zu beteiligen, ging der Nutzen von DEISA noch viel weiter", betont Professor Carloni. "Die Durchführung von experimenteller Forschung gestaltet sich für unsere vietnamesischen Kollegen recht schwierig, aber mit den Computern können sie rechnerfern arbeiten. In unserem Fall verschaffte die DEISA-Infrastruktur den vietnamesischen Forschern eine wunderbare Chance, in das spannende Gebiet der RNA- Arzneimittelentwicklung einzusteigen und dieses Wissen mit nach Hause zu nehmen." RNAHIV war nicht das einzige HIV-Forschungsprojekt, das von Kompetenz und Leistungsstärke à la DEISA profitierte. Auch innerhalb des EU-finanzierten ViroLab-Projekts(öffnet in neuem Fenster) ("Virtual laboratory") kam DEISA zum Einsatz, um rechenintensive Simulationen zur Molekulardynamik zum Laufen zu bringen. Eine große Herausforderung im Zusammenhang mit dem HIV-Virus ist die Vielzahl der mit der Krankheit assoziierten Stämme. Einige Stämme sind resistenter gegen ein Arzneimittel, aber zugänglicher für andere. ViroLab unterstützt den Entscheidungsfindungsprozess, den Ärzte bei der Behandlung von HIV-Patienten durchdenken müssen. Der behandelnde Arzt beginnt mit einer Analyse der HIV-Virussequenz, von der ihr Patient befallen ist. Ist die Analyse abgeschlossen, so liegt den Ärzten eine Auswahl geeigneter Arzneimittel vor. ViroLab fragt automatisch Daten aus einer Vielzahl von Quellen ab. "Virtual laboratory" findet die Resistenzmanagement-Vorschriften, die von den üblicherweise angewendeten HIV-Arzneimittelresistenz-Interpretationssystemen mittels Medikamentenbewertungs-Datenbanken wie Rega, HIVdb und ANRS zur Verfügung gestellt werden. Inzwischen kommen anonymisierte Patientendaten aus den teilnehmenden Krankenhäusern hinzu, während von der US National Library of Medicine die vorhandene Literatur in Bezug auf den speziellen HIV-Stamm bereitgestellt wird. Das Projekt entwickelte und veröffentlichte als Teil der ViroLab-Forschungsarbeit außerdem eine Studie zur Validierung des "Bindungsaffinitätsrechners" (Binding affinity calculator, BAC), mit dessen Hilfe man besser bestimmen kann, welche Medikamente wirksamer und welche resistenter sein könnten. Im ViroLab-Projekt konnten die Wissenschaftler durch den Einsatz DEISA-gestützter Simulationen auf atomarer Ebene Einblicke in die zwischen den Molekülen bestehenden Wechselwirkungen zwischen einem HIV-Stamm und speziellen Medikamenten gewinnen. Auf diese Weise konnte innerhalb des Projekts sondiert werden, wie resistenzassoziierte Mutationen miteinander interagieren und Veränderungen in der Medikamentenanbindung bewirken. Diese Art der Forschung könnte eingesetzt werden, um die bestehenden Vorschriften zur Auswahl von Arzneimitteln zu bewerten. Noch mehr hoffen lassen die potenziellen Auswirkungen der Arbeit auf die zukünftige Medikamentenentwicklung. RNAHIV und ViroLab waren nur zwei Projekte im Bereich Biowissenschaften, die von der im Rahmen von DEISA2 geschaffenen Hochleistungsrecher-Hardware, Software, dem Support sowie auch der gewonnenen Kompetenz profitierten. DEISA2 wurde mit Mitteln in Höhe von 10,24 Mio. EUR (Gesamtbudget des Projekts: 18,65 Mio. EUR) im Unterprogramm "e-Science grid infrastructures" des Siebten Forschungsrahmenprogramms der EU (RP7) finanziert. Nützliche Links: - "Distributed European infrastructure for supercomputing applications"(öffnet in neuem Fenster) - DEISA2-Projektdatensatz auf CORDIS - E-Infrastruktur-Programme/Projekte(öffnet in neuem Fenster) - RNAHIV-Projekt(öffnet in neuem Fenster) - ViroLab-Projekt(öffnet in neuem Fenster) Weiterführende Artikel: - Vereinte Supercomputer simulieren Sonne, Klima und den Körper des Menschen - Supercomputer bringen Klimamodelle auf Touren - Supercomputing beruhigt aufgewühlte See - Supercomputing gets its own superhero(öffnet in neuem Fenster) - The grid: a new way of doing science(öffnet in neuem Fenster) - Europas Fusionsforscher erschließen Supercomputer-Ressourcen - ViroLab to use DEISA infrastructure(öffnet in neuem Fenster)