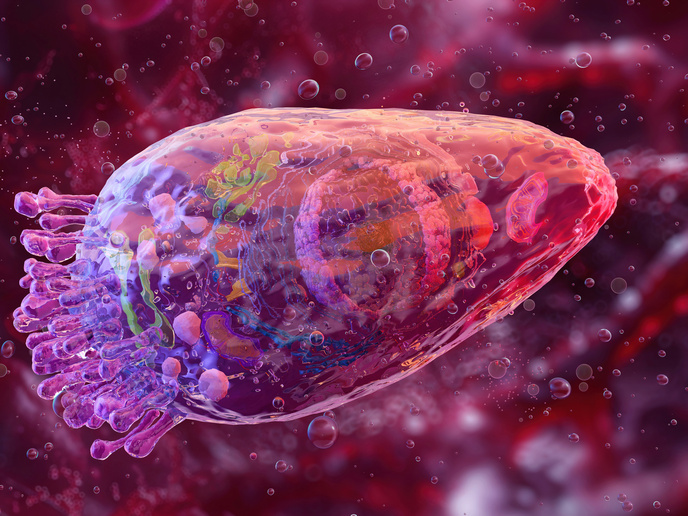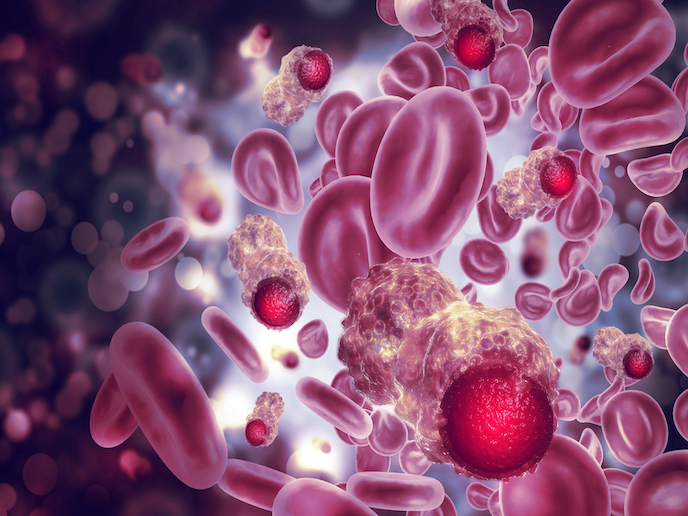Erforschung der Genominstabilität bei Krebs
Resistenz gegenüber Krebsmedikamenten stellt ein weitverbreitetes Problem dar. Eine neuere Entdeckung, gemäß der ein Zusammenhang zwischen Arzneimittelresistenz, Rezidiv der Erkrankung und Tod bei nichtkleinzelligem Lungenkrebs hergestellt wird, ist die Variation der Anzahl der Kopien von Genomregionen, entweder innerhalb von Zellen desselben Tumors oder in verschiedenen Tumorregionen einer betroffenen Person. „Innerhalb eines Tumors gibt es Veränderungen der Kopienzahl, die in jeder Zelle zu beobachten sind“, erklärt Eva Grönroos, leitende Laborforscherin am Francis Crick Institute(öffnet in neuem Fenster). „Das Ergebnis lautet, dass nicht alle Zellen innerhalb des Tumors über eine identische Chromosomenkopienzahl verfügen und dass sie unterschiedliches Erbgut aufweisen“, fügt sie hinzu. Im Rahmen des vom Europäischen Forschungsrat(öffnet in neuem Fenster) (ERC) finanzierten und von Professor Charles Swanton(öffnet in neuem Fenster) geleiteten Projekts PROTEUS versuchten die Forschenden, diese Entdeckung zu vertiefen, wobei sie Lungenkrebsmodelle entwickeln, die dazu beitragen könnten, die evolutionären Muster hinter dieser Genominstabilität zu erkennen. „Eine der in diesem Projekt gewonnenen Erkenntnisse lautet, ist, dass diese Veränderungen nicht völlig zufällig(öffnet in neuem Fenster) erfolgen“, berichtet Grönroos. „Die gleichen Fortschritte und Verluste werden oft innerhalb eines bestimmten Tumortyps beobachtet, was auf einen krebstypspezifischen Selektionsdruck hinweist, der das Tumorgenom prägt.“
Komplexe Rolle des Immunsystems im Kampf gegen Krebs verstehen
Im Zuge des Projekts nutzten die Forschenden eine als „Tumor-Barcoding“ bezeichnete Methode, um die Wirkung potenzieller Tumorsuppressoren auf das Tumorwachstum zu erkunden. Anhand von Mausmodellen und der CRISPR-Cas9-Genomeditierungstechnologie zur Inaktivierung bestimmter Gene zeigte das Team, dass die Inaktivierung einiger dieser vermuteten Suppressorgene in sehr großen Tumoren resultierte(öffnet in neuem Fenster), während andere an der Entstehung des Tumors beteiligt waren. „Im Verlauf dieses Projekts haben wir und andere die komplexe Rolle des Immunsystems(öffnet in neuem Fenster) in Hinsicht auf die Entstehung und das Fortschreiten von Tumoren schätzen gelernt“, erklärt Swanton.
Auswirkungen auf Einschätzung von Luftverschmutzung und Lungenkrebs
Beispielsweise ist seit langem bekannt, dass Luftverschmutzung mit einer erhöhten Inzidenz von Lungenkrebs einhergeht, aber das Team des Projekts PROTEUS hat neue Zusammenhänge zwischen Umweltschadstoffen und Tumorwachstum gefunden. Unter Einsatz von epidemiologischen Daten, Mausmodellen und In-vitro-Experimenten veranschaulichte das Team, dass Luftverschmutzung Lungenkrebs fördert(öffnet in neuem Fenster) – und das ganz unabhängig von genetischen Mutationen. Seine Ergebnisse belegten, dass die Exposition gegenüber Schadstoffen das Immunsystem aktiviert, das entzündungsfördernde Signalstoffe freisetzt. Diese wirken dann auf bereits vorhandene, mutierte Zellen in der Lunge ein und fördern die Tumorigenese – einen Prozess, bei dem sich normale Zellen in Tumoren umwandeln. Die Ergebnisse von PROTEUS deuten darauf hin, dass der „Initiator“(öffnet in neuem Fenster) eines Tumors eine bereits existierende mutierte Zelle ist, die eine Krebsmutation trägt, die mit dem Alter erworben werden kann. Der Tumor-„Promotor“ könnte den Untersuchungen zufolge die Luftverschmutzung sein, die eine Entzündungsreaktion auslöst, die die Tumorbildung beschleunigt. „Wir glauben, dass unsere Arbeit über Luftverschmutzung und Lungenkrebs die weitreichendsten Auswirkungen von all unseren projektinternen Erkenntnissen hat“, schätzt Grönroos ein.
Erkenntnisse in Krebstherapeutika einfließen lassen
Mit ihrer Arbeit über Luftverschmutzung, Entzündungen und Tumorpromotion hoffen die Forschenden, neue Wege zu finden, um die Entstehung von Krebs durch den Einsatz entzündungshemmender Mittel bei Hochrisikopopulationen zu verhindern und auf diese Weise ein neues Feld der molekularen Krebsprävention zu erschließen. Die Forschung wird mithilfe einer neuen ERC-Finanzhilfe weiterverfolgt. „Daten von uns und anderen haben ergeben, dass der Körper mit mutierten Zellen übersät ist, die niemals Krebs bilden“, fügt Grönroos hinzu. „Mit unserer aktuellen Finanzhilfe konzentrieren wir uns darauf, welche Faktoren den Übergang von einer mutierten, indolenten Zelle zu Krebs fördern könnten.“