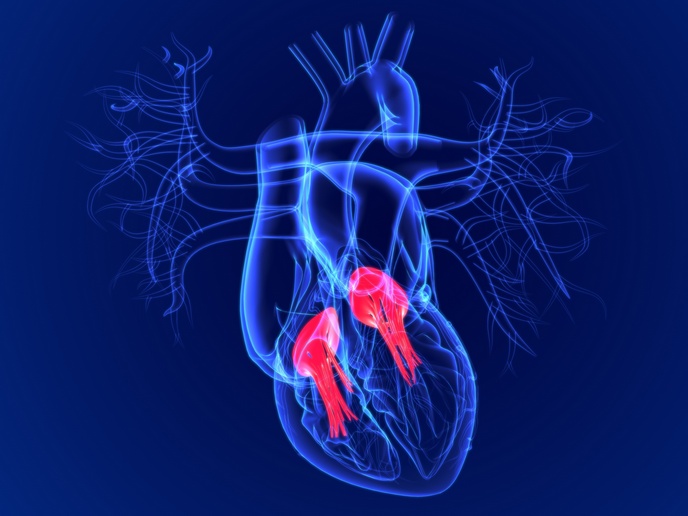Schaffung tierversuchsfreier Alternativen für die Medikamentenentwicklung
Orale Medikamente sind eine weit verbreitete und wirksame Behandlungsform für viele Krankheiten – mit großer Nachfrage. Die meisten von der pharmazeutischen Industrie entwickelten Medikamente werden aufgrund ihrer suboptimalen Löslichkeit jedoch nicht effizient vom Verdauungstrakt absorbiert. Dies verringert ihr Wirkpotenzial. „Viele der führenden Wirkstoffkandidaten aus der Arzneimittelforschung wurden für die Bindung an Rezeptoren optimiert, was mit einer schlechten Wasserlöslichkeit einhergeht“, erklärt Brendan Griffin(öffnet in neuem Fenster), Professor für Pharmazie am University College Cork. „Darüber hinaus gibt es im Zusammenhang mit erweiterten chemischen Entdeckungen auch einen zunehmenden Trend zu Medikamenten mit größerem Molekulargewicht als Leitkandidaten, die in der Regel auch sperriger, voluminöser und weniger wasserlöslich sind“, fügt er hinzu. In dem EU-finanzierten Projekt InPharma(öffnet in neuem Fenster) entwickelten Forscher neue tierversuchsfreie Methoden zur Entwicklung und Prüfung oraler Medikamentenformulierungen. Im Rahmen des Projekts wurde auch ein sektorübergreifendes Ausbildungsprogramm durchgeführt, um 13 Nachwuchsforscher zur Revolutionierung der ethischen oralen Medikamentenentwicklung in Europa zu befähigen. „Neben der Schulung von Nachwuchswissenschaftlern im Hinblick auf das 3R-Prinzip(öffnet in neuem Fenster) und die Förderung tierfreier Ansätze in der Medikamentenentwicklung konzentrierte sich die Forschung, an der sie direkt beteiligt waren, auf die Entwicklung von In-vitro- und In-silico-Ansätzen, mit denen die Notwendigkeit, Entwicklungsformulierungen an Tieren zu testen, verringert oder beseitigt werden kann“, so Griffin.
Nutzung von Berechnungswerkzeuge zur Entwicklung neuer Medikamentenformulierungen
Die im Rahmen des Projekts InPharma durchgeführten Forschungsarbeiten befassten sich mit der Entwicklung optimierter Formulierungen mit Hilfe von Berechnungswerkzeuge, anstatt Prototypformulierungen in Tiermodellen zu testen, um die optimale Formulierung für den Übergang zu klinischen Versuchen am Menschen zu ermitteln. „Im Rahmen der Forschungsarbeiten wurden auch verbesserte biorelevante In-vitro-Testmethoden entwickelt, die die Leistung der Formulierung beim Menschen besser vorhersagen können, was die Durchführung von Formulierungsversuchen an Tieren als Vorhersage für die Leistung beim Menschen überflüssig machen würde“, erläutert Griffin.
Erfolgreiche Ausbildung von Nachwuchsforschern
Über die direkte Forschung hinaus führte das Projekt auch zu einer Reihe vielversprechender Ergebnisse. Dreizehn Nachwuchsforscher schlossen das „Industrial Doctorate“-Programm(öffnet in neuem Fenster) für die Doktorandenausbildung ab, und alle werden voraussichtlich bis Ende dieses Jahres ihren Doktortitel erhalten. Die Arbeit des Projekts InPharma hat auch zu 30 von Fachleuten begutachteten wissenschaftlichen Veröffentlichungen geführt und es werden noch weitere erwartet. „Wir haben die industriell-akademische Forschung zwischen den Partnern in diesem EU-finanzierten Netzwerk gestärkt, indem wir akademische Einrichtungen mit großen multinationalen pharmazeutischen Unternehmen in ganz Europa verknüpft haben“, merkt Griffin an und fügt hinzu: „Dies wird künftige sektorübergreifende Kooperationen und weitere Forschungsstipendien ankurbeln.“
Förderung der Arzneimittelindustrie in Europa
Das Projekt hat die Forschung im Bereich der tierversuchsfreien Ansätze bei der Entwicklung von Medikamentenformulierungen maßgeblich vorangebracht. Da alle Forschungsergebnisse über einen offenen Zugang verbreitet wurden, werden die Erkenntnisse über den gesamten Industriesektor hinweg für die Förderung tierversuchsfreier Ansätze genutzt. „Da sich wichtige Partner aus der pharmazeutischen Industrie in Europa an InPharma beteiligen, wie Johnson & Johnson, Roche, Bayer, AstraZeneca, Zentiva und Merck, wird sich dies außerdem direkt auf die Forschungs- und Entwicklungsansätze dieser Unternehmen auswirken“, bemerkt Griffin. Das Team plant nun ein breites Spektrum von Forschungskooperationen innerhalb des Netzwerks und bemüht sich um weitere Forschungsmittel. Darüber hinaus möchte das Projektteam über das gesamte Netzwerk hinweg gemeinsame Arbeiten einreichen, um neue EU-Finanzierungsmöglichkeiten zu sondieren. „Schließlich wollen wir mit unseren 13 Nachwuchsforschern in Verbindung bleiben, um ihre Karriere und ihre Fortschritte im pharmazeutischen Forschungssektor zu verfolgen“, sagt Griffin. InPharma wurde im Rahmen der Marie-Skłodowska-Curie-Maßnahmen(öffnet in neuem Fenster) unterstützt.