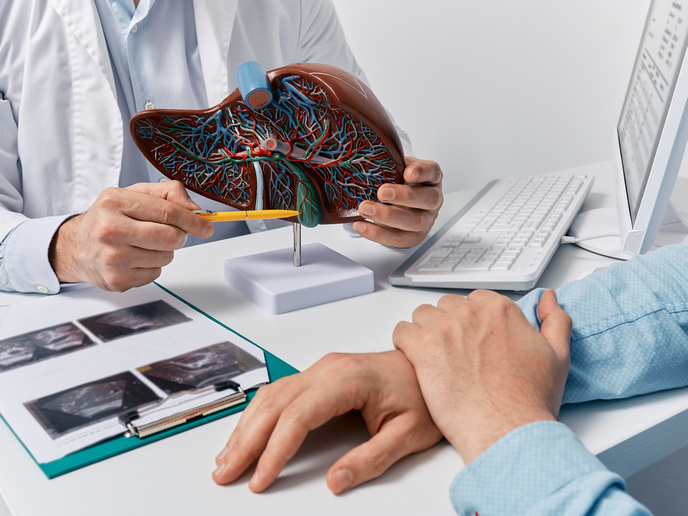Die Geheimnisse des körpereigenen Thermostats könnten zu Innovationen im Gesundheitswesen führen
Trotz großer Temperaturschwankungen können Säugetiere ihre Körper Kerntemperatur (Tcore) auf etwa 37 °C auf, wobei der hypothalamische präoptische Bereich (POA) des Gehirns eine wichtige Rolle spielt. „Es ist zwar bekannt, dass einige thermische Ausgleichsprozesse Stoffwechselenergie erfordern – beispielsweise zum Zittern oder zur Aktivierung von braunem Fett –, doch wie dies genau geschieht, insbesondere über längere Zeiträume, ist nach wie vor ungeklärt“, erklärt Jan-Erik Siemens(öffnet in neuem Fenster) vom Projekt Acclimatize, das vom Europäischen Forschungsrat(öffnet in neuem Fenster) (ERC) finanziert wurde. Um diese Frage zu klären, stützte sich das Projekt „Acclimatize“ auf die jüngste Entdeckung des Teams, des ersten bekannten molekularen Temperatursensors(öffnet in neuem Fenster) in den thermoregulatorischen Neuronen des POA – einem thermosensitiven Ionenkanal, der als transient receptor potential melastatin 2 – TRPM2(öffnet in neuem Fenster) bekannt ist. Diese Entdeckung ermöglichte dem Team, in vivo POA-Temperaturstimulationsexperimente an Mäusen durchzuführen und dabei die Funktionsweise thermoregulatorischer Neuronen unter Verwendung von TRPM2 als molekularem Marker zu untersuchen. „Neben dem Nachweis, wie eine bestimmte Gruppe von Gehirnzellen auf Wärme reagiert, haben unsere Entdeckungen über die schwankenden Temperaturen in tiefen Hirnstrukturen weitreichende Auswirkungen auf die Forschung“, erklärt Siemens vom Institut für Neurologie der Medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg(öffnet in neuem Fenster), dem Projektleiter.
Von der akuten Wärmehomöostase zur langfristigen Wärmeakklimatisierung
Acclimatize interessierte sich weniger für die besser verstandenen Prozesse der Regulierung der Körpertemperatur im akuten oder kurzfristigen Bereich, sondern vielmehr dafür, wie Säugetiere dies über längere Zeiträume tun. „Die meisten Säugetiere können sich über längere Zeiträume, in der Regel Wochen bis Monate, an Temperaturänderungen anpassen. Denken Sie nur daran, wie wir uns im Sommer an steigende Temperaturen gewöhnen“, ergänzt Siemens. Es war beispielsweise bekannt, dass Mäuse bei der Anpassung an wärmere Temperaturen ihr braunes Fett, ihr wichtigstes Wärmeregulierungsorgan, verlieren, was folgende Fragen aufwirft: Wird dies vom Nervensystem gesteuert, und wenn ja, wie? Um dies zu untersuchen, visualisierte das Team bestimmte Neuronen im POA, ließ Mäuse in Inkubatoren an wärmere Temperaturen akklimatisieren und suchte anschließend mithilfe neurophysiologischer Techniken nach synaptischer Plastizität – jedoch ohne nennenswerte Ergebnisse. „Wir haben jedoch eine deutlich erhöhte Aktivität in diesen thermoregulatorischen Neuronen festgestellt, die mit der Zeit zunahm. Überraschenderweise schienen sie, obwohl sie tief im Gehirn liegen, die Körpertemperatur zu messen. Eine Hypothese lautet, dass der Blutfluss ins Gehirn zuerst den POA erreicht und dort Wärme abgibt“, erklärt Siemens. Dank dieser Entdeckung konnte das Team das zum ersten Mal ein wichtiges Molekül für die Hitzeakklimatisierung(öffnet in neuem Fenster) identifizieren, das aus NaV1.3-Ionenkanälen besteht, die für die erhöhte neuronale Aktivität entscheidend sind, welche die peripheren Organe offenbar auf Hitze vorbereitet.
Auswirkungen auf die Biomedizin
Das Projekt „Acclimatize“ bot die Möglichkeit, die Zusammenhänge zwischen dem Akklimatisierungsmechanismus und dem Energiestoffwechsel mit besonderem Schwerpunkt auf Adipositas weiter zu untersuchen. „Die Forschung ist noch nicht abgeschlossen, daher können wir noch keine endgültigen Schlussfolgerungen ziehen, aber es scheint wahrscheinlich, dass Hitzeakklimatisierung zumindest bei Mäusen bestimmten Formen von Fettleibigkeit entgegenwirken kann“, erklärt Siemens. Laut Siemens könnte diese Erkenntnis, sofern sie sich bestätigt, zu zwei möglichen Therapieansätzen führen. Erstens könnte die durch fokussierten Ultraschall erzeugte Wärme, die beispielsweise tief in das Gehirn eindringt, genutzt werden, um die neuronale Aktivität im POA zu modulieren und so die gesundheitlichen Vorteile der Wärmeakklimatisierung bei Adipositas nachzuahmen. Zweitens könnte ein Medikament entwickelt werden, das unter Verwendung von Capsaicin(öffnet in neuem Fenster) (dem feurigen Bestandteil von Chilischoten) periphere Hitzerezeptoren aktiviert, deren Signale bis zum POA wandern und dort die Neuronen zur Hitzeakklimatisierung auslösen. Darüber hinaus untersucht Siemens, inspiriert vom Acclimatize-Projekt, derzeit, wie der Prozess der Wärmeakklimatisierung Menschen mit Herz-Kreislauf-Risiken beispielsweise während Hitzewellen helfen könnte. „Die Frage, wie wir die Vorteile der Wärmeakklimatisierung klinisch nachahmen können, ist ein sehr spannendes neues Forschungsgebiet, das sich aus diesem Förderprojekt des Europäischen Forschungsrats ergibt“, fasst Siemens zusammen.